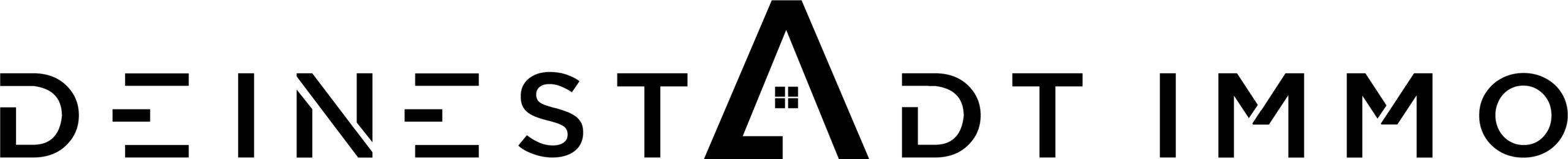Die
Credit Suisse
(CS) steckt in Problemen. Das hat viele Gründe. Die massiven Zinserhöhungen der Notenbanken drücken den Wert der Anleihen im Portfolio der Bank. Dazu kommt, dass die zweitgrößte Bank der Schweiz eigene Fehler begangen hat. So lieh sie 2021 dem Hedgefonds Archegos Capital Kredite, kurz bevor der Geldempfänger in die Pleite rutschte. Da waren die Daten der CS wohl nicht auf dem neuesten Stand. Mit diesem Anfängerfehler hat das CS-Management den Ruf der Bank beschädigt.
Um jetzt die Märkte und Anleger zu beruhigen, hat die Schweizer Nationalbank (SNB) kürzlich der
CS
einen Notkredit von 50 Milliarden Schweizer Franken (gut 50 Milliarden Euro) gewährt. Damit wollte die SNB für Finanzstabilität sorgen und die CS mit Liquidität ausstatten. Doch das hat die Märkte nur kurz beruhigt. Bald zogen die Sparer weitere Einlagen ab und die CS-Aktien ging erneut auf Talfahrt.
Die CS gehört zu den „systemrelevanten“ Banken
Derzeit verhandeln die Beteiligten über eine „Zwangsrettung“ der CS durch die andere Schweizer Großbank
UBS
. Die will aber umfangreiche Garantien von der Regierung in Bern, damit sie nicht selbst Gefahr läuft, in Schieflage zu geraten. Laut CNBC beläuft sich die Garantiesumme auf umgerechnet sechs Milliarden Euro.
Die CS gilt als „to big to fail”. Das bedeutet: Sie ist so wichtig für die internationale Finanzwirtschaft, dass sie nicht untergehen darf. So käme es zu dramatischen Verwerfungen. Auch in den USA und Europa.
Verhandlungen unter Zeitdruck
Deshalb blicken Experten und Laien gebannt nach Zürich. Dort sitzen am Verhandlungstisch neben den Top-Managern der Banken auch die Schweizer Regierung und die Finanzmarktaufsicht Finma. Allen Beteiligten ist klar: Noch am heutigen Sonntag muss eine Lösung gefunden werden. Sonst droht am Montagmorgen ein Chaos an Börsen und Finanzmärkten. Das sehen auch die Notenbanken der USA und Großbritanniens so. Laut Medienberichten machen sie Druck auf die Schweizer.
Beobachter hoffen auf Rettung der CS
Viele Sparer und Anleger auch hierzulande sind besorgt über die dramatische Entwicklung in Zürich. Was könnte passieren, wenn sich die Protagonisten nicht einigen und die CS noch tiefer in den Schlamassel gerät?
Manchmal hilft ein Blick in die Vergangenheit. Nach der Finanzkrise war die UBS in Nöten und musste von der Schweiz gerettet werden. Ausgerechnet die UBS, die jetzt der CS unter die Arme greifen soll. Die UBSler dürften also wissen, was zu tun ist.
2008 erhielt die UBS 54 Milliarden Dollar von der Nationalbank SNB und sechs Milliarden aus Bern. Also ungefähr so viel Geld, wie die CS diese Woche bekommen hat. Damals erlebte die Welt eine globale Bankenkrise, ausgelöst von faulen Immobilienkrediten in den USA.
Die Notenbanken haben unter anderem insofern ihre Lehren aus der Finanzkrise gezogen, dass Banken inzwischen mehr Eigenkapital vorhalten müssen, um nicht so schnell in Gefahr zu geraten.
Trotzdem hat es jetzt die CS erwischt. Was aber weniger an zu hohen Schulden liegt als vielmehr daran, dass die Marktteilnehmer der CS misstrauen. Das zeigt auch der abgestürzte Aktienkurs.
Die CS darf nicht an die Wand fahren
Wie gesagt: Alle Beteiligten bemühen sich um eine rasche Sanierung der angeschlagenen CS. Die Chancen stehen gut, dass bis Sonntagmittag Erfolge vermeldet werden können.
Sollte das nicht gelingen, werden Anleger und Verbraucher am Montagmorgen eine „Zeitenwende 2.0“ erleben. Mit dramatischen Folgen:
-
Der
Aktienkurs der CS dürfte kollabieren
. -
Ähnliches dürfte mit den Kursen der
Unternehmensanleihen
passieren. Milliardenwerte lösen sich binnen Minuten in Luft auf. -
Weil die CS so wichtig ist, strahlte ihr Untergang auf die ganz Branche aus: Die Aktienkurse von
Deutsche Bank
und
Commerzbank
würden in den Keller rauschen. Auch die Finanzwirtschaft in den anderen Ländern würde Opfer der Turbulenzen. Und die Börsen wahrscheinlich weltweit prozentual zweistellig einbrechen. -
Damit besorgte Sparer nicht ihre
Konten plündern (
„Bank Run“), müssten die Regierungen umfangreiche Garantien aussprechen. Kanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Linder müssten vor die Medien treten und erklären: „Das Geld der Sparer ist sicher.“ Denn die Bankensicherung von 100.000 Euro je Kunde und Geldhaus reicht dafür nicht. -
EZB und die US-Notenbank Fed dürften ihre scharfe
Zinserhöhungs-Politik
kaum wie bisher weiterverfolgen. Im schlimmsten Fall müssten sie die Märkte sogar mit neuen Billionen fluten. Eine Folge: Die
Inflation
würde noch weiter in die Höhe schießen. Leidtragende wären Verbraucher, Sparer und Anleger. Das kann keiner wollen – auch deshalb macht gerade die Fed Druck auf die Schweiz.
Eine hohe Inflationsrate könnte hoch verschuldete Staaten in neue Probleme bringen, wenn sie die – zwangsläufig – steigenden Zinslasten nicht mehr bedienen können. Italien ist ein Kandidat für ein solches Szenario.
Verhandler zum Erfolg verurteilt
Noch blicken viele mit Hoffnung nach Zürich und drücken den Verhandlungsführern die Daumen. Und die meisten Beobachter schließen ein Scheitern der Verhandlungen aus. Es wird eine Lösung geben, weil es sie geben muss.
Die aktuelle Krise in Zürich zeigt aber: Ganz ohne Staaten geht die Chose nicht. In Krisenphasen sind die Märkte nicht so stabil, dass sie sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. In höchster Not müssen Regierungen Garantien aussprechen, um die Märkte zu beruhigen und Chaos zu verhindern.
Damit sich die aktuelle Krise nicht bald in irgendeinem anderen Teil der Welt wiederholt, müssen Regierungen und Finanzaufsichten dafür sorgen, dass die Finanzmärkte resistenter werden. Hoffentlich mehr als ein frommer Wunsch.
Zum Autor
#Immobilien #Finanzen #Aachen