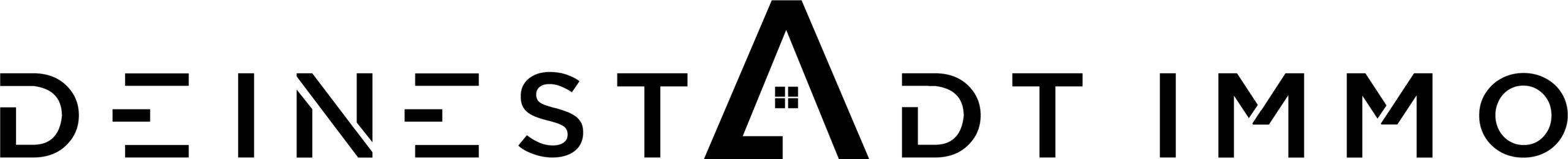Lief unseren Vorfahren einst ein Säbelzahntiger über den Weg, vergewisserten sie sich im Regelfall nicht zuerst, ob sie es mit einem menschenfreundlichen Exemplar der Gattung zu tun hatten. Sie ergriffen beim Anblick der 20 Zentimeter langen gebogenen Eckzähne idealerweise schnurstracks die Flucht und rannten, so schnell sie konnten, um ihr Leben. In der Steinzeit waren Vorurteile, die als mentale Abkürzungen unsere Entscheidungsfindung unterstützen, von existenzieller Wichtigkeit.
Heutzutage ist unser Überleben glücklicherweise nicht mehr an die erfolgreiche Flucht vor Säbelzahntigern geknüpft. Dennoch arbeitet unser Gehirn immer noch ressourcenschonend, um potenziell gefährliche Situationen stereotypisch einzuordnen und blitzschnelle Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Wir lernen somit auch schon von klein auf, Menschen intuitiv zu „stereotypisieren“ und damit anhand von ihren sichtbaren Merkmalen unbewusst Kategorien zuzuordnen, die mit gewissen Eigenschaften verknüpft sind. Über die Jahre verinnerlichen wir auf diese Weise Attribute, die wir automatisch sozialen Gruppen wie Männern und Frauen, Alten und Jungen oder auch Menschen verschiedener Nationalitäten und Religionen zuschreiben.
Und das passiert nicht selten: Wer kennt nicht die Klischees, dass Frauen zu blöd zum Einparken und Blondinen nicht mit hoher Intelligenz gesegnet sind, Männer im Grunde nur Macht und Sex wollen, Hartz-IV-Empfänger faul und SUV-Fahrer egoistisch sind. Auch Vorurteile, die sich auf verschiedene Nationalitäten beziehen, gibt es zahlreich: So sind Italiener vermeintlich Muttersöhnchen, Russen trinken gerne, und Deutsche gelten als zuverlässig, aber humorlos. Diese Liste der Stereotypen und Vorurteile lässt sich beliebig lang fortsetzen. Und jetzt mal Hand aufs Herz: Wer von uns kann von sich behaupten, keinem dieser Vorurteile jemals zum Opfer gefallen zu sein?
Die große Gefahr von Vorurteilen liegt darin, dass sie Diskriminierung von Menschen zur Folge haben können. Untersuchungen von Lehrpersonal zeigen etwa, dass Vornamen von Schülerinnen und Schülern, die weniger privilegierten Elternhäusern zugeschrieben werden (wie etwa Chantal oder Kevin), unabhängig von ihrer tatsächlich erbrachten Leistung eher mit Verhaltensauffälligkeiten assoziiert und damit potenziell auch ungerechtfertigt schlechter benotet werden. Der Grat zwischen harmlosen Stereotypen und Diskriminierung ist damit sehr schmal.
Forscher der Universität Köln stellten im Herbst 2019 basierend auf knapp 1000 Anfragen mit fiktiven Nutzerprofilen fest, dass Männer mit türkischem Namen in Deutschland schwerer eine Mitfahrgelegenheit fanden. Während der Durchschnitt der Zusagen im Falle von klassischen deutschen Namen bei 59 Prozent lag, wollten nur 44 Prozent einen Menschen mit einem türkischen Männernamen mitnehmen. Laut der Studie bevorzugten die meisten also lieber einen „Maximilian Schmidt„ als einen “Hamid Yilmaz“ als Beifahrer. Wohlgemerkt ohne weitere Informationen über die beiden Herren vorliegen zu haben.
Eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Konstanz stellte außerdem fest, dass ausländische Namen auch im Bewerbungsprozess die Chancen auf eine Einladung zum Jobinterview wesentlich verschlechtern. Auch wer mit einem ausländischen Namen eine Wohnung sucht, hat es erheblich schwerer als jemand mit einem klassischen deutschen Namen.
Vorurteile und die hieraus resultierende Diskriminierung von Menschen machen auch vor der Arbeitswelt nicht Halt. Das Klischee des ewigen gestrigen alten Mannes, der um jeden Preis das Patriarchat aufrechterhalten möchte, ist omnipräsent und genauso reduzierend und diskriminierend wie das Bild der pauschal unterqualifizierten Quotenfrau, die nur ihres Geschlechts wegen eingestellt wurde.
Vorurteile betreffen ebenso das Alter von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie auch ihr optisches Erscheinungsbild. So werden Menschen regelmäßig in Schubladen gesteckt, weil sie gesellschaftlichen Schönheitsidealen entsprechen oder auch, weil sie das nicht tun. Auch rund um Familienplanung und Erziehung ranken sich viele Geschlechterklischees und Rollenerwartungen: So wird Frauen im gebärfähigen Alter durchgehend ein Kinderwunsch unterstellt, auch wenn sie gar keine Kinder bekommen wollen oder können. Entsprechen Frauen dieser Erwartung und bekommen Kinder, können sie es der Gesellschaft wiederum auch nicht recht machen: Halten sie trotz Kind weiterhin an ihrer Karriere fest, werden sie als Rabenmütter abgestempelt, wohingegen ihnen fehlende berufliche Ambitionen unterstellt werden, wenn sie für die Familie im Job kürzertreten oder ihre Arbeitszeit reduzieren.
Im Gegenzug entsprechen Männer nicht der gesellschaftlichen Rollenerwartung und werden mit Skepsis und Widerständen konfrontiert, falls sie eine längere Elternzeit nehmen oder gar längerfristig aufgrund der Erziehung ihrer Kinder beruflich zurücktreten möchten. Auch rund um die soziale und ethnische Herkunft von Menschen ist gesellschaftliches Schubladendenken weit verbreitet, das sich auch in der Arbeitswelt in Rassismus und Klassismus niederschlagen kann.
Vorurteile in der Arbeitswelt haben nicht selten zur Konsequenz, dass Menschen Jobs gar nicht erst bekommen, ungerechtfertigte Leistungsbewertungen erhalten oder nicht entsprechend ihren Fähigkeiten, ihres Potenzials sowie ihrer Leistungen gefördert und befördert werden. Dies ist nicht nur für Betroffene verheerend, sondern auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht für Unternehmen schädlich.
Eine von Schubladendenken geprägte Kultur fördert Silodenken, Ellenbogenmentalität und intransparente Kommunikation. In der Folge nehmen Unzufriedenheit und Konflikte am Arbeitsplatz zu, während das Zusammenhörigkeitsgefühl sowie die Motivation und Produktivität der Belegschaft zunehmend sinken. Dies führt wiederum zu einem Anstieg der Fluktuation, wodurch nicht nur hohe Kosten aufgrund des daraus resultierenden Rekrutierungs- und Einarbeitungsaufwands entstehen, sondern auch Know-how und wertvolle Talente verlorengehen.
Basieren Einstellungsprozesse im Unternehmen auf dem „bewährten Bauchgefühl“ von Entscheiderinnen und Entscheidern, ohne objektiv messbare Bewertungskriterien und standardisierte Verfahren zu nutzen, sind Beurteilungsfehler bei Personalentscheidungen und damit auch die Diskriminierung von Bewerberinnen und Bewerbern häufig die Konsequenz. Gemäß des Affinity Bias stellen Menschen bevorzugt Menschen ein, die ihnen ähneln.
Dieses Ähnlichkeitsprinzip hat nicht nur zur Folge, dass qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber nicht berücksichtigt, sondern auch dass immer homogenere Teams gezüchtet werden. Die daraus resultierende Monokultur wird zunehmend verstärkt, wenn Bestandsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, die nicht ins Schema passen, Diskriminierung und Ausgrenzung erleben und in der Konsequenz das Unternehmen verlassen. Homogene Teams wiederum neigen häufiger zum Gruppendenken (Conformity Bias), wodurch abweichende Meinungen oder konträre Ansätze oft nicht offen adressiert werden, um der Mehrheitsmeinung zu entsprechen und nicht negativ aufzufallen.
Dies fühlt sich auf den ersten Blick womöglich bequem für alle Beteiligten an, denn ein Konsens bei gemeinsamen Entscheidungen ist in der Regel weitaus schneller gefunden als bei heterogenen Teams. Jedoch birgt eine Mehrheit von Gleichgesinnten die Gefahr, dass diskriminierende und toxische Verhaltensweisen und Praktiken in Unternehmen weniger kritisch hinterfragt werden und sich dadurch fest etablieren können und zugleich das Risiko steigt, Innovationspotenzial einzubüßen. So zeigt eine Studie der Boston Consulting Group und der TU München einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Vielfalt in einem Unternehmen und dessen Innovationsfähigkeit. Außerdem sollte nicht unterschätzt werden, dass mit einer diversen Belegschaft auch eine größere Perspektivenvielfalt einhergeht, wodurch im gleichen Zuge auch neue Zielgruppen und Märkte erschlossen werden können.
Die deutsche Wirtschaft leidet aktuell bereits unter großem Personalmangel. Eine Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass heute schon die Geschäfte jedes zweiten Unternehmens durch fehlende Fachkräfte beeinträchtigt sind. Dieser Fachkräftemangel wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen, denn die Babyboomer-Generation geht in Rente. Bis 2036 werden damit knapp 30 Prozent der aktuellen Erwerbstätigen wegfallen.
Die Konsequenz ist eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft bei zugleich steigender Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung. Selbst bei einer hohen Nettozuwanderung wird es bis Mitte der 2030er-Jahre zu einer Abnahme der Menschen im Erwerbsalter kommen. Umso paradoxer ist es, dass Unternehmen in Zeiten des sich stetig zuspitzenden Fachkräftemangels und des demografischen Wandels, in dem der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte immer intensiver wird, dennoch auf qualifizierte Talente verzichten. Vorurteilsbehaftetes Handeln und Denken in der Arbeitswelt setzt die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Landes aufs Spiel. Wir können uns Schubladendenken damit schlichtweg nicht mehr leisten.
Zum Autor
#Immobilien #Finanzen #Aachen